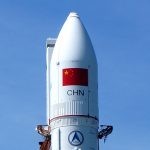Lunare Solarzell-Fabrik: Künftige Mondstationen könnten die Solarzellen für ihre Stromversorgung vor Ort herstellen – und 99 Prozent des Transportgewichts für die nötigen Rohstoffe einsparen. Denn das Glas für die Photovoltaikmodule lässt sich ohne große Aufbereitung aus lunarem Regolith erzeugen, wie Tests nun belegen. Kombiniert mit einer hauchdünnen Perowskit-Halbleiterschicht entstehen so Solarzellen mit einer Effizienz von immerhin bis zu zehn Prozent.
Ob China, die USA oder andere Nationen: Es geht zurück auf den Mond. Anders als bei den Apollo-Missionen sollen die Astronauten diesmal länger auf dem Erdtrabanten bleiben, unter anderem in lunaren Raumstationen und Mondbasen. Doch dafür benötigen die künftigen Mondbewohner Baustoffe, Sauerstoff, Wasser und Energie – und diese müssen möglichst vor Ort gewonnen werden. Hauptquelle für die mineralischen Rohstoffe ist der lunare Regolith, Energie und Wärme liefert die Sonne.

99 Prozent Transportgewicht eingespart
Wie sich auf dem Mond Solarzellen herstellen lassen, haben nun Julian Cuervo Ortiz von der Universität Potsdam und seine Kollegen ausprobiert. „Stellen Sie sich eine permanente Mondbasis, ein Dorf oder sogar eine Stadt auf dem Mond vor, die von der fast durchgehenden Sonnenstrahlung am lunaren Südpol versorgt wird“, so das Team. Um diese Sonnenenergie zu nutzen, sind jedoch unzählige Solarmodule nötig – und diese können nicht alle per Raketen zum Mond gebracht werden.
„Wir schlagen eine Lösung vor, die 99 Prozent des Gewichts für den Materialtransport einspart“, erklären die Forschenden. Die Idee dahinter: Statt die ganzen Photovoltaikmodule von der Erde zum Mond zu transportieren, könnte man das als Trägermaterial benötigte Glas vor Ort herstellen – aus lunarem Regolith. „Das Highlight unserer Studie ist, dass wir das benötigte Glas für unsere Solarzellen direkt und ohne Aufbereitungsprozesse aus dem Mondregolith gewinnen können“, erklärt Seniorautor Felix Lang von der Universität Potsdam.